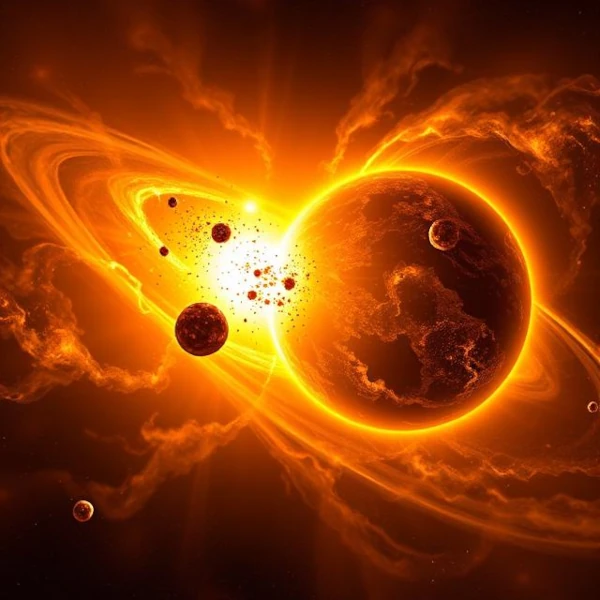
Was, wenn unser Sonnensystem einst riesige Welten beherbergte, die heute verschwunden sind? Außerirdische Diamanten, die in Meteoriten gefunden wurden, belegen die vergangene Existenz von Super-Erden, massiven Gesteinsplaneten, die einst die junge Sonne umkreisten, bevor sie in den interstellaren Raum ausgestoßen wurden.
Super-Erden gehören zu den häufigsten Exoplaneten, die in der Milchstraße beobachtet werden. Doch unser Sonnensystem besitzt keine. Dieses scheinbare Fehlen, obwohl die Natur ihre Entstehung begünstigt, deutet darauf hin, dass sie einst existierten, bevor sie verschwanden. Die überzeugendsten materiellen Beweise stammen von bestimmten Meteoriten, die Hochdruck-Diamanten enthalten, die sich im Inneren massiver planetarer Körper gebildet haben, die heute verloren sind.
Analysen von Ureilit-Meteoriten haben Diamantkristalle von mehreren Dutzend Mikrometern Größe enthüllt, die metallische Einschlüsse (Fe, Ni, Cr) aufweisen, die sich bei über 20 GPa gebildet haben. Solche Drücke können nur in Gesteinsplaneten erreicht werden, die mehrere Erdmassen schwer sind, weit über die Fähigkeiten eines einfachen Asteroiden hinaus.
Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Dichte der Erde entspricht ein Druck von 15 bis 20 GPa einem Körper von etwa 2 bis 5 Erdmassen, also einer Super-Erde. Diese Diamanten bezeugen daher die Existenz eines planetaren Mantels, der internen Bedingungen ausgesetzt war, die mit denen von Uranus oder Neptun vergleichbar sind.
N.B.:
Diamanthaltige Ureilite könnten die einzigen mineralogischen Zeugen der verlorenen Super-Erden des frühen Sonnensystems sein. Ihre inneren Strukturen bezeugen Drücke, die für einfache Asteroiden unzugänglich sind, und stützen die Idee einer planetaren Population, die vor der Stabilisierung der heutigen Umlaufbahnen verschwand.
Simulationen von Sean Raymond und Alessandro Morbidelli zeigen, dass Jupiter als gravitative Barriere fungierte und die Einwärtswanderung von Super-Erden im Sonnensystem verhinderte. Diese Wechselwirkung führte zu ihrem Auswurf oder ihrer Zerstörung. Das Phänomen wird im Rahmen des Grand-Tack-Modells beschrieben, bei dem Jupiter bis auf 1,5 AE zum Sonneninneren wandert, bevor er sich wieder nach außen bewegt und planetare Embryonen destabilisiert.
Das Grand-Tack-Modell ist eine dynamische Hypothese, die von Alessandro Morbidelli und Sean Raymond vorgeschlagen wurde und die frühe Wanderung von Jupiter und Saturn in der Urnebel beschreibt. Laut diesem Modell wanderte Jupiter zunächst bis auf ≈1,5 AE zur Sonne hin, bevor er durch den resonanten Effekt von Saturn „umkehrte“. Diese Bewegung hätte die inneren planetaren Embryonen gestört, mögliche Super-Erden ausgestoßen und die Endmasse des Mars begrenzt. Der Begriff „Tack“ stammt aus der Segelmanöver-Bezeichnung „Wende“ und illustriert die gravitative Richtungsänderung der beiden Gasriesen.
Eine Super-Erde, die eine Auswurfgeschwindigkeit von über 42 km/s erreicht, hätte zu einem interstellaren Planeten werden und das Sonnensystem endgültig verlassen können.
Der Almahata-Sitta-Meteorit, der 2008 im Sudan niederging, enthält hochreine Diamanten, die durch Spektroskopie bestätigt wurden. Die metallischen Einschlüsse, die er enthält, erfordern eine Entstehung bei Drücken von 20 bis 25 GPa. Laut Farhang Nabiei (EPFL, 2018) stammen diese Diamanten von einem Mutterkörper von der Größe des Merkur oder einer Super-Erde mit mehreren Erdmassen.
Wissenschaftler verwenden mehrere Techniken, um diese außerirdischen Diamanten zu datieren und zu charakterisieren:
Das Fehlen von Super-Erden könnte die gravitative Stabilität des Sonnensystems begünstigt haben. Ohne diese Zwischenmassen besetzen die heutigen Planeten fast kreisförmige Umlaufbahnen und vermeiden zerstörerische Resonanzen. Diese anhaltende Stabilität ermöglichte die langsame und kontinuierliche Entwicklung des Lebens auf der Erde, ein außergewöhnliches Szenario in der Exoplanetenstatistik.
| Systemtyp | Beobachteter Anteil | Gravitationsstruktur | Physikalische Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Einfaches System (ein Stern) | ≈ 45% | Ein einzelner zentraler Stern | Stabil und häufig bei massearmen Sternen wie der Sonne. |
| Binärsystem | ≈ 40% | Zwei Sterne in gegenseitiger Umlaufbahn um ihren Baryzentrum | Kann planetare Störungen verursachen, begünstigt aber auch den Materieaustausch. |
| Tertiäres System (Dreifach) | ≈ 10% | Zwei nahe Sterne, begleitet von einem dritten, weiter entfernten Stern | Bedingte Stabilität: Erfordert eine strenge orbitale Hierarchie, um gravitative Auswürfe zu vermeiden. |
| Multiples System (≥ 4 Sterne) | ≈ 5% | Verschachtelte Umlaufbahnen um mehrere sekundäre Baryzentren | Sehr langfristig instabil; oft Ergebnis der anfänglichen Fragmentierung einer Molekülwolke. |
Quellen: Raghavan et al. (2010), ApJS, 190, 1; Tokovinin (2018), ApJS, 235, 6; Gaia-Mission, ESA (2023).
| Spektraltyp | Durchschnittliche Masse (M☉) | Anteil multipler Systeme (ca.) | Physikalische Implikation |
|---|---|---|---|
| O–B (massereich) | ≈ 8–40 | ≈ 80–100% | Bildung in instabilen Kernen, starke Wolkenfragmentierung, sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Binär- und nahe Mehrfachsysteme. |
| A–F | ≈ 1.5–2.5 | ≈ 60–75% | Mäßige Fragmentierung; häufige, aber hierarchischere Mehrfachsysteme. |
| G (sonnenähnlich) | ≈ 1.0 | ≈ 45% | Gemischt: ein erheblicher Anteil an Binärsystemen, aber eine signifikante Anzahl einzelner Sterne. |
| K | ≈ 0.6–0.9 | ≈ 30–40% | Weniger Begleiter; protoplanetare Scheiben oft stabiler. |
| M (Rote Zwerge) | ≈ 0.1–0.5 | ≈ 20–30% | Dominante Population in der Galaxie; geringe Multiplizität führt zu einer Mehrheit einzelner Sterne. |
| Alle Typen (gewichteter Durchschnitt) | — | ≈ 40–45% | Durch die Anfangsmassenfunktion (IMF) gewichteter Durchschnittswert: Der hohe Anteil an Roten Zwergen senkt den Gesamtmittelwert. |
N.B.:
Die oft gelesene Behauptung, dass „80 % der Sterne binär sind“, ist für beobachtete **massereiche** Sternpopulationen (O–B) korrekt, aber irreführend, wenn sie auf alle Sterne der Galaxie ausgeweitet wird. Die Galaxie wird numerisch von Roten Zwergen (Typ M) dominiert, die eine geringe Multiplizitätsrate aufweisen, was zu einem gewichteten Durchschnitt von ≈40–45 % multiplen Systemen auf galaktischer Ebene führt.